Die EU plant eine Herabstufung des Schutzstatus’ des Wolfes im Rahmen der Berner Konvention und FFH-Richtlinie. Was bedeutet das für Österreichs Jagd, Herdenschutz & Monitoring? Jetzt informieren!
Die Berner Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarates aus dem Jahr 1979. Sie ist ein Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume. Ihr gehören 46 europäische Staaten, vier afrikanische Länder sowie die Europäische Union (EU) als internationale Organisation an. In der EU dient die Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL; 92/43/EWG) zur Umsetzung der Berner Konvention.
Der Wolf (Canis lupus) ist in der Berner Konvention aktuell unter Anhang II gelistet (also „streng geschützt“), und in der FFH-RL, je nach Mitgliedsland innerhalb der EU, im Anhang IV („streng geschützt“) bzw. Anhang V („geschützt“). Für Österreich wird der Wolf im Anhang IV geführt, und der dadurch festgeschriebene strenge Schutz untersagt eine reguläre Bejagung. Erlaubt sind nur Einzelentnahmen, wenn zum Beispiel ein Wolfsindividuum ernste wirtschaftliche Schäden verursacht oder die Sicherheit der Menschen gefährdet.
Das Hauptziel der FFH-RL ist, wild lebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Tierarten, die in der FFH-RL im Anhang V geführt werden, sind „von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können“. Dazu gehören zum Beispiel in Österreich die Gams (Rupicapra rupicapra), der Goldschakal (Canis aureus), der Baummarder (Martes martes) und der Schneehase (Lepus timidus). Diese Arten sind also geschützt, können aber durch Bejagung genutzt werden, vorausgesetzt, dass der günstige Erhaltungszustand belegt (z.B. durch aktives
Monitoring) und nicht gefährdet ist.»

EU erwägt Herabstufung des Wolf-Schutzstatus in der Berner Konvention
Die Diskussion über den Umgang mit dem Wolf nahm spätestens am 25. 11. 2022 an Fahrt auf, als das EU-Parlament in einer Resolution die Europäische Kommission aufforderte, den Umgang mit dem Wolf neu zu bewerten. Als die Schweiz einen Antrag stellte, den Schutzstatus des Wolfes in der Berner Konvention zu ändern, reagierte die EU dennoch ablehnend. Die für den damaligen Bericht zusammengestellten Daten ergaben zu dem Zeitpunkt eine Populationsgröße von über 19.000 Individuen in den EU-Mitgliedstaaten und über 21.500 in ganz Europa – ohne Belarus und Russland (Boitani et al. 2022).
Die ablehnende Haltung zum Schweizer Vorstoß lautete damals: „Auf der Grundlage der aktuellen Daten ist eine Herabsetzung des Schutzstatus aller Wolfspopulationen aus wissenschaftlicher und naturschutzfachlicher Sicht nicht gerechtfertigt. Der Erhaltungszustand der Art ist auf dem gesamten Kontinent nach wie vor uneinheitlich, wobei der Erhaltungszustand nur in 18 von 39 nationalen Teilen der biogeografischen Regionen in der Union als günstig bewertet wird. Dies wird durch die neuesten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen zum Erhaltungszustand der Art bestätigt, die sich aus der Berichterstattung gemäß Artikel 17 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates und der Entschließung Nr. 8 (2012) der Berner Konvention ergeben. Die anhaltenden Bedrohungen für die Art, einschließlich neuer Bedrohungen, wie Grenzzäune und Wolf-Hund-Hybridisierung, erfordern ebenfalls die Beibehaltung des strengen Schutzstatus.“
Doch ein Jahr später sah die Europäische Kommission die Sache anders. Am 20. Dezember 2023 schlug sie vor, den internationalen Schutzstatus des Wolfes zu ändern. Als Grundlage dafür nannte sie zusätzlich zu dem Bericht von Boitani et al. (2022) eine weitere Analyse über die wachsende europäische Wolfspopulation (Blanco und Sundseth 2023). Die Studienautoren fassten über 19.000 E-Mails als Reaktionen auf eine Pressemeldung der Europäischen Kommission zusammen. Über diese Pressemeldung wurden Gemeinden, Wissenschafter und alle Interessierten aufgefordert, aktuelle Daten über die lokale Wolfspopulation zu übermitteln. Sie erfassten durch diese Meldungen aus den Mitgliedstaaten die Anzahl der Wölfe in der EU ganz ähnlich wie zuvor bei Boitani et al. (2022), nämlich mit 20.356 Individuen. Blanco und Sundseth (2023) zeigten auch, dass 71 % der Antwortenden für eine Beibehaltung des Schutzstatus und 28 % für eine Änderung des Status seien.
Die Meinungen waren je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Beiträge aus Belgien, Italien, Polen, Spanien, Portugal und Frankreich waren mit überwältigender Mehrheit für die Beibehaltung des Schutzstatus’. Dagegen sprachen sich die Teilnehmern aus Finnland, den Niederlanden, Österreich, der Tschechischen Republik und Slowenien mit Mehrheit für eine Änderung des Schutzstatus’ aus. In Schweden und Deutschland waren die Meinungen gleichmäßiger verteilt, obwohl sich in beiden Fällen mehr Menschen für als gegen die Beibehaltung des Schutzstatus aussprachen (Blanco und Sundseth 2023). Nichtsdestotrotz resultierte die aktuelle Entscheidung der EU vom 23. September 2024 in einer Absichtserklärung, bei dem nächsten Treffen der Mitglieder der Berner Konvention (ein Standing Committee, also Ständiger Ausschuss) vorzuschlagen, den Schutzstatus des Wolfes von Anhang II („streng geschützt“) in Anhang III („geschützt“) zu ändern. Diese Änderung wurde am 3. Dezember 2024 tatsächlich vom Standing Committee der Berner Konvention beschlossen. Doch wie geht es nun voraussichtlich weiter und was würde dies für die EU-Mitgliedstaaten bedeuten?
Zunächst muss einem klar sein: Es handelt sich voraussichtlich um einen langwierigen Prozess, der auch noch Jahre dauern kann. Zunächst haben die Unterzeichnerstaaten der Berner Konvention bis zum 7. März 2025 Zeit, noch Einsprüche gegen die Herabstufung des Schutzstatus’ einzubringen. Geschieht dies nicht, wäre der Ball dann wieder bei der EU-Kommission, die weiters dem EU-Parlament und dem EU-Rat eine Änderung des Schutzstatus’ in der FFH-RL vorschlagen darf.
Dieses Verfahren zur Änderung der Anhänge der FFH-RL ist in Artikel 19 der Richtlinie festgelegt. Darin wird erläutert, dass die Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs IV an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, vom EU-Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig beschlossen werden müssen (Norer 2024, Trouwborst und Fleurke 2019).

Wolfsmanagement: EU will Schutzstatus ändern – neue Chancen für die Jagd
Ziel des Antrages der EU in Bezug auf den Schutzstatus des Wolfes war es, den Mitgliedstaaten künftig mehr Spielraum im Wolfsmanagement zu geben und insbesondere die Nutztierhaltung zu schützen. Wenngleich die Mitgliedstaaten mehr Handlungsfähigkeiten in der Gesetzgebung hätten und die Überprüfung seitens der EU geringer ausfällt, so ist eine der Folgen vermutlich ein deutlich komplexeres Wolfsmanagement. Was sich definitiv nicht ändern wird, ist die Verpflichtung, den günstigen Erhaltungszustand in Österreich zu erreichen und entsprechende Daten zu erheben und zu kommunizieren.
Aus wissenschaftlicher Sicht bedeutet die Änderung des Schutzstatus von Anhang IV auf Anhang V vor allem die Notwendigkeit eines verlässlichen Monitorings, idealerweise länderübergreifend. Dieses muss als Grundlage eine engere Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Forschungseinrichtungen umfassen, um die Dynamiken der Wolfsbestände zu verfolgen und fundierte Managemententscheidungen treffen zu können. Dabei muss der Bestand auf einem Niveau bleiben, das langfristig die Erhaltung des Wolfes in Europa sicherstellt. Nicht alle Länder konnten in den letzten Erhebungen einen zunehmenden Trend der Wolfsbestände verzeichnen, so wurde zum Beispiel aus Kroatien oder Bosnien-Herzegowina, Montenegro oder Nord-Mazedonien von einem abnehmenden Trend der Bestände berichtet (Boitani et al. 2022). In den Ländern mit eindeutigem Wolfsbestandszuwachs sollten nicht nur bei einer Änderung des Schutzstatus Investitionen in Herdenschutzmaßnahmen erhöht und ein aktives und systematisches Monitoring etabliert werden. Die EU-Kommission fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die verfügbaren EU-Finanzmittel für den Herdenschutz auszuschöpfen, um die Viehhaltung in betroffenen Gebieten zu sichern. Zudem werden Leitdokumente zur Erfassung des günstigen Erhaltungszustandes zur Verfügung gestellt.
Wolfsmanagement in Österreich: Was die Schutzstatus-Änderung bedeutet
Österreich würde bei einer Änderung des Schutzstatus des Wolfes wie gesagt mehr Handlungsspielraum bekommen. Sofern der günstige Erhaltungszustand oder die Erreichung dessen nicht gefährdet ist (Trouwborst et al. 2017), kann Österreich eine Bejagung des Wolfes in Betracht ziehen, muss es aber nicht! In Nordspanien und in Polen ist der Wolf schon jetzt in Anhang V der FFH-RL gelistet, und dennoch herrscht in beiden Ländern ein sehr strenges Schutzregime für den Wolf.
Wenn Österreich bzw. die Bundesländer nach der Änderung des Schutzstatus auf EU-Ebene und der entsprechenden Änderung der gesetzlichen Grundlagen in Österreich einen anderen Weg gehen möchten, braucht es zunächst einmal ein aktives und systematisches Monitoring, um Gewissheit über den Bestand und dessen Entwicklung zu bekommen. Nur so kann dokumentiert werden, ob der günstige Erhaltungszustand erreicht wird bzw. zukünftig nicht gefährdet ist. Gleichzeitig muss – dort, wo es möglich und zumutbar ist –massiv in den Herdenschutz investiert werden. Natürlich muss man auch klar darüber reden, was mit nicht schützbaren Flächen passieren soll, denn schließlich können auch dort Wölfe durch- oder einwandern und Nutzvieh reißen. Besondere Ausgleichszahlungen sowie generelle Unterstützung durch Personal könnten hier ein Anfang sein. Also: Selbst wenn die EU den Schutzstatus ändert, kann eine Wolfsbejagung nur dann eingeleitet werden, wenn die EU-Vorgaben in Bezug auf den günstigen Erhaltungszustand erfüllt sind. In Österreich sind Naturschutz und Jagd Ländersache, und daher ist es an den Bundesländern, ihre Gesetze entsprechend anzupassen und zu einem bundesweiten Monitoring beizutragen.
Aktuell erarbeitet das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der BOKU Wien im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft sowie aller Bundesländer außer Wien und dem Burgenland ein Lebensraum- und Konfliktpotenzialmodell für den Wolf in Österreich. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die angespannte Diskussion weiter zu versachlichen und langfristige Lösungen für ein Miteinander von Mensch und Wolf zu erarbeiten, damit die Nutztierhaltung in Österreich auch künftig ermöglicht wird und die rechtlichen Vorgaben aus internationalen Abkommen berücksichtigt werden können.
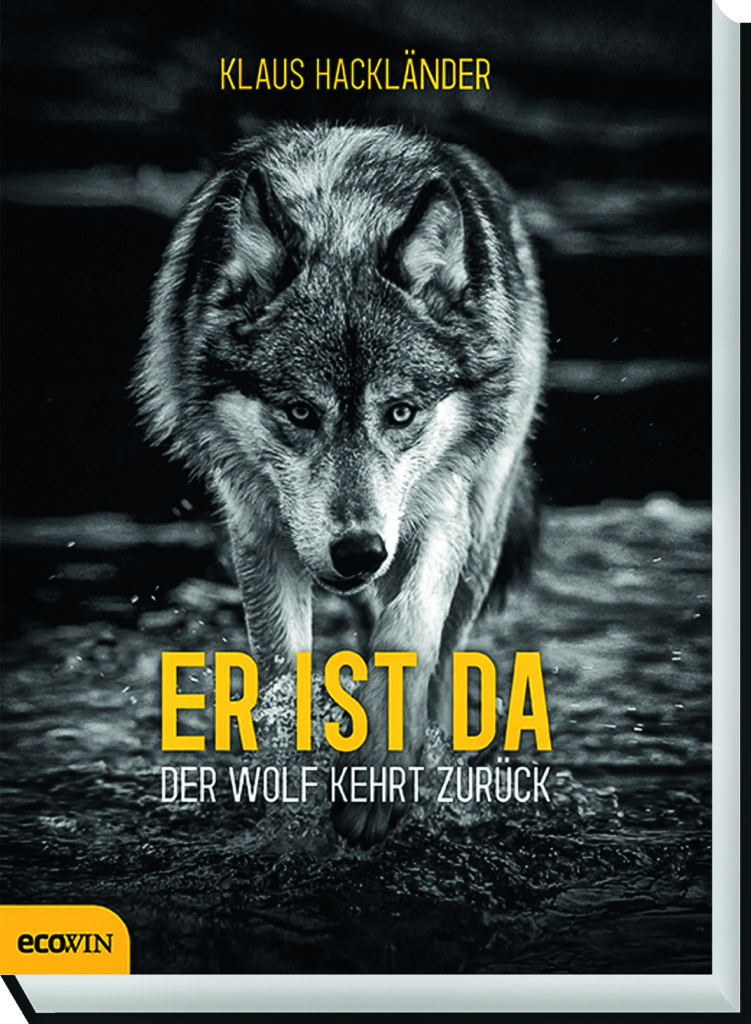
Buchtipp
„Er ist da“ von Klaus Hackländer
EcoWing
ISBN 978-3-7110-0258-7
€ 24,–
In seinem Sachbuch sammelt der Experte für Wildbiologie, Jagdwirtschaft und Biodiversität, Univ.-Prof. Dr. Klaus Hackländer, Daten, Fakten und Erfahrungsberichte zu Wolfsschutz, Problemwölfen und sicherem Umgang
mit dem Raubtier.
Bestellung: http://www.jagd.at
Literatur:
Blanco JC, Sundseth K (2023): The situation of the wolf (Canis lupus) in the European Union – An In-depth analysis. A report of the N2K Group for DG Environment, European Commission, https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-43167-analyse-commission-europeenne-loup-2023.pdf
Boitani et al. (2022): Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe, Standing Committee 42nd meeting, 28.11.-2.12.2022 https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-2/1680a7fa47
Norer R (2024): Wolfsmanagement im Alpenraum, Rechtsfragen zwischen Artenschutz und Weidehaltung. Verlag Österreich, Wien 2024.
Trouwborst A, Boitani L, Linnell J (2017): Interpreting ’ favourable conservation status’ for large carnivores in Europe: how many are needed and how many are wanted? Biodiversity and Conservion 26, 37–61, https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-016-1238-z
Trouwborst A, Fleurke, FM (2019): Killing Wolves Legally: Exploring the Scope for Lethal Wolf Management under European Nature Conservation Law. Journal of International Wildlife Law and Policy 22(3), 231-273, https://ssrn.com/abstract=3761365












