Die Allgegenwärtige
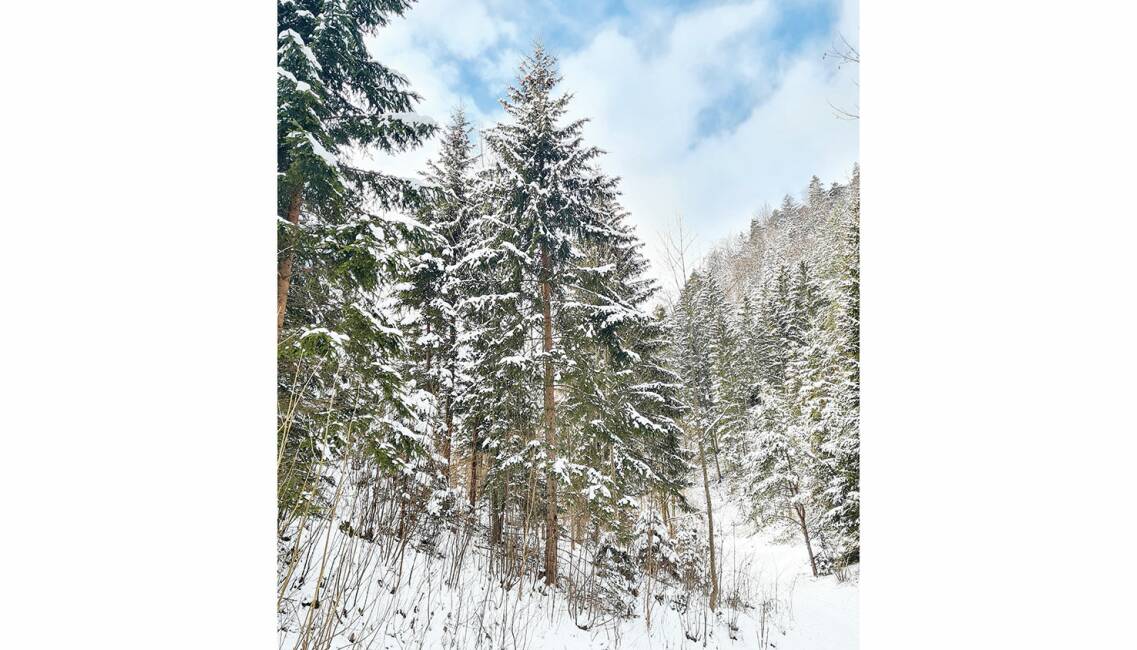
Kaum eine zweite Baumart wird – aufgrund ihrer Häufigkeit – so oft als Beutebruch genutzt wie die Fichte. Ein Baumporträt.
So gut wie jedem Volksschulkind ist sie bekannt: die Fichte. Als bisheriger „Brotbaum“ der Forstwirtschaft steht sie allerdings aufgrund des Klimawandels und der daraus profitierenden Schädlinge, wie die Borkenkäfer, unter Druck. So kommt sie wegen ihrer im Gegensatz zu anderen Baumarten schnellen Umtriebszeit von etwa
80–100 Jahren auch in Gebieten vor, in denen sie naturgemäß nicht vorkommen würde.
Die Nadeln sind im Vergleich zur Weißtanne spitz zulaufend und verteilen sich rund um den Zweig. Die Rinde ist feinschuppig und rötlich.
Spektakulär ist im Frühjahr der massenhafte Pollenflug, der standortbedingt nur alle paar Jahre vorkommt. Die weiblichen, rötlichen Blüten, aus denen sich die bekannten Zapfen bilden, stehen anfangs noch aufrecht, bis sie sich zur Reifung abwärts biegen und schließlich verholzen. Sie fallen nach einjähriger Reifung im Ganzen ab und werden oft fälschlicherweise als Tannenzapfen „angesprochen“, wobei diese jedoch schon am Zweig auseinanderfallen.
Abhängig vom Standort bildet die Fichte unterschiedliche Ökotypen, die anhand ihrer Astform unterschieden werden: Bei „Plattenfichten“ sind die Zweige am Ast eher horizontal angeordnet. Man findet sie zum Beispiel in windstarken Extremstandorten auf dem Berg. „Kammfichten“ ordnen ihre älteren Zweige senkrecht an, was wiederum Schneedruck am Ast verhindert. „Bürstenfichten“ bilden eine Zwischenform. Die Kronenform der Fichte ist bei genügend Freiraum kegelförmig.
Ebenso abhängig vom Standort ist die Ausbildung der Wurzeln: In schweren Böden wurzelt die Fichte eher flach, wodurch sie windwurfgefährdet ist. In gut durchlüfteten Böden bildet sie ein tiefes Wurzelsystem, jedoch nie eine Pfahlwurzel aus.
Im jagdlichen Kontext ist die Fichte vor allem als die typische Baumart für den Bruch bekannt. Sei es als Bruchzeichen für Hundeführer, als Schützen- oder Standesbruch am Jagdhut, als Inbesitznahmebruch oder als Letzter Bissen – hier wird bevorzugt zur Fichte gegriffen.